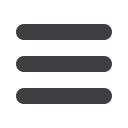
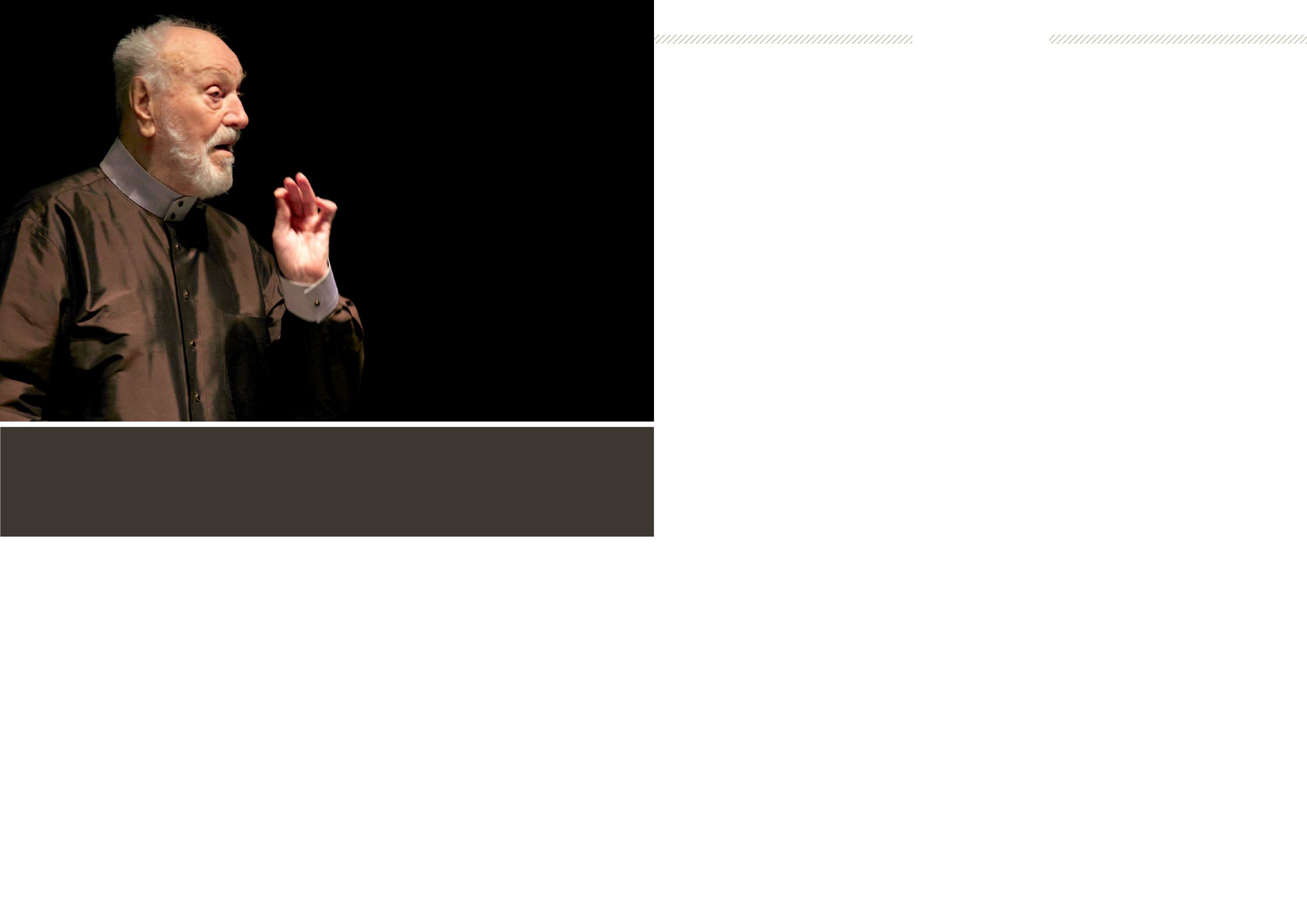
53 | Kultur
Kurt Masur
Herr Prof. Masur, Sie sind dem Usedomer
Musikfestival bereits seit zwanzig Jahren
verbunden – als erster Schirmherr und seit
2012 als Ehrenschirmherr. Wann sind Sie
zum ersten Mal mit dem Festival in Kontakt
getreten?
Meine erste Begegnung – das war vor 21 Jahren. Es war
eine Überraschung, als man zur Gründung des Usedomer
Musikfestivals an mich herantrat. Ich bin immer auf einer
der Ostseeinseln gewesen, auf dem Darß in Ahrenshoop
oder auf Usedom in Heringsdorf. Diese Orte kenne ich
zumTeil wie meineWestentasche, deshalb haben mich die
Aktivitäten zur Gründung des Usedomer Musikfestivals
anfangs etwas erschreckt. Als man mir sagte, man wolle ein
Festspiel ausrichten, fragte ich: „Glaubt ihr, dass die Fischer
zu Euch ins Konzert kommen?
(lacht)
Das Entscheidende
wird sein, dass ihr die Verbindung zu den Menschen schafft
und deren Interessen weckt”. Das Festival wuchs dann ganz
natürlich.
Und es hat 2008 Nachwuchs bekommen mit
dem Baltic Youth Philharmonic – ein junges
Orchester, das die talentiertesten Nach-
wuchsmusiker des Ostseeraums versammelt.
Die jungen Musiker vereint die Vision grenz-
überschreitender Kooperation und eines
gemeinsamen Europas. Ist das ein tragfähiges
Zukunftskonzept?
Das ist das tragfähigste Zukunftskonzept überhaupt! Die
Musiker des Baltic Youth Philharmonic kommen aus zehn
verschiedenen Nationen. Das ist schon ungeheuer interes-
sant! Allein schon festzustellen, in welcher Weise sie Mozart
oder Beethoven verstehen und gemeinsam erarbeiten, was
das Glaubwürdigste an der Interpretation ist – das ist für
den Dirigenten interessant, das ist für das junge Orchester
interessant und das ist für das Publikum interessant. Deswe-
gen mache ich diese Meisterkurse am liebsten mit jungen
Orchestern. Dabei lernen die Musiker von den Dirigenten
und die Dirigenten lernen von den Musikern. Diese Zusam-
menführung ist mir das Wichtigste geworden.
Ihr Programm für Peenemünde ist mutig: Sie lassen
Richard Wagners Ouvertüre zur Oper „Die Meister-
singer“ spielen. Führende Nazis waren große Wagner-
verehrer. Wie vermitteln Sie das den jungen Musikern
des Baltic Youth Philharmonic, die aus Polen, Russland,
Estland, Litauen und den anderen Ostseeanrainerstaa-
ten kommen?
Es ist immer unterschiedlich, ganz gleich wo ich mich befinde. Manchmal
warte ich ab, wie die Reaktionen der jungen Leute sind, der Orchester
und der jungen Dirigenten. Dabei überrascht mich sehr oft, dass sie
wirklich ratlos sind und grundlegende Fragen stellen. Da muss ich Erklä-
rungen finden, die für sie überzeugend sind. Das berührt dann Fragen,
die die Rolle und Funktion der Musik – und der Kunst überhaupt – im
Leben eines Menschen betreffen. Im Leben des Komponisten, wie auch
im eignen Leben.
Ihre Einstellung zur Musik wurde auch von eige-
nen Kriegserlebnissen geprägt. Mit 17 Jahren waren
Sie schon Soldat und widmen sich nun an einem der
widersprüchlichsten Aufführungsorte des Usedomer
Musikfestivals, dem Kraftwerk der ehemaligen Heeres-
versuchsanstalt in Peenemünde, der Nachwuchsarbeit.
Was geht Ihnen vor diesem Hintergrund durch den
Kopf?
Der Name Peenemünde war auch in Kriegszeiten für uns geheimnisum-
wittert. Kaum einer wusste, was dort eigentlich geschah und zumTeil
war es auch gar nicht bekannt. Mir gehen daher vor allem Erinnerungen
und Gedanken an die Nachkriegszeit durch den Kopf. Da erlebte ich
Dinge, die mich tief berührt haben, zum Beispiel in Lemberg, einer der
am stärksten zerstörten Städte. Dass ich dort auf Sympathien stieß,
überraschte mich. Das Orchester sah mich in der Ecke sitzend im
Studium der Partituren vertieft, da kam plötzlich ein Mädchen aus dem
Orchester und brachte mir einen Apfel. Das hat mich so tief berührt,
das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie sagte einfach: „Guten Tag,
wir begrüßen Sie”. Gerade diese kleinen Erlebnisse haben mich sehr
bewegt.
War es besonders schwer als Dirigent eines Landes, das
den Krieg zu verantworten hatte, in den Ländern im
östlichen Europa zu konzertieren?
Ich wurde immer mit unserer Geschichte konfrontiert. Meine ersten
Gastspiele in den baltischen Staaten, in Estland, Lettland und Litauen,
waren in dieser Hinsicht besondere Erlebnisse. Dort erstaunte mich,
dass ich von den Menschen, die unter dem Krieg am stärksten zu leiden
hatten, als einer der jüngsten deutschen Dirigenten akzeptiert wurde.
Sie sagten: „Der ist ja viel zu jung, um einer der Mörder gewesen zu
sein“. Und damit begann schon die Überlegung der Menschen, ihre
Einstellungen zu verändern.
Was haben Sie aus diesen Erfahrungen gelernt, was Sie
jungen Dirigenten und Orchestern auf den Weg geben
möchten?
Das Sich-Umstellen-Lernen mit einer Vision vom Klang und von der
Aussagefähigkeit des Orchesters, in unterschiedlichen Situationen. Das
ist eine Herausforderung, mit der man immer wieder konfrontiert wird,
wenn man international tätig ist. Es ist kein großes Kunststück, im Fest-
saal der Wiener Philharmoniker schön zu spielen, das klingt von sich aus
schön. Einmal hörte ich Swjatoslaw Richter auf einem halb verstimmten
Klavier, und es wurde trotzdem zum Erlebnis. Damals sagte ich mir: Das
geht eben auch. Ähnliche Freiräume haben auch Dirigenten, das betrifft
nicht nur den Aufführungsort, sondern auch das Programm. Junge
Dirigenten müssen sich ihrer Befindlichkeit klar werden und wissen, was
sie ausdrücken wollen. Darum habe ich manchmal, wenn die 9. Sinfonie
von Beethoven für ein Publikum zu oft gespielt wurde, zunächst etwas
anderes ins Programm gesetzt, zum Beispiel Schönebergs „Ein Über-
lebender aus Warschau“. Musik ist nicht nur schön. Ich möchte, dass
das Publikum sich an andere Klänge gewöhnt, bevor „Freude schöner
Götterfunken” ertönt. Und in dem Moment, in dem man das erreicht
hat, merkt man erst, wie neu und wie frisch Musik sein kann, wenn sie
authentisch vermittelt wird.
Welche positiven Energien kann Musik den Nachwuchs-
musikern und dem Publikum vermitteln?
Sie kann viel mehr, als die meisten sich vorstellen können. Ganz gleich,
wo ich mit Orchestern war, es erstaunte mich, wie Musik den Menschen
verdeutlichte, dass wir uns doch näher sein können als wir glauben. Das
sind auch Erscheinungsformen der Musik oder der Kunst, die mir immer
mehr die Erkenntnis vermittelt haben, wir können sehr viel erreichen
mit demVersuch, den Menschen begreiflich zu machen, dass wir eigent-
lich dieselbenWünsche haben:Wir wollen Frieden, wir wollen Harmo-
nie, wir wollen versuchen, miteinander so positiv zu leben, dass wir alle
glücklich sein können.
Und was wünschen Sie dem Usedomer Musikfestival
für die Zukunft?
Ich wünsche, dass Usedom nicht überschwemmt wird vom Massentou-
rismus, sodass dadurch die Schönheit der Natur verloren geht.Wenn
man aber nach einemTag in der Natur Usedoms am Abend zusam-
mensitzt und gute Musik hört und dabei das Gefühl hat, dass dieWelt
vereint ist – in der Schönheit der Natur, des Lebens, des Geistes und
auch in demWillen, dem Leben einen Sinn geben zu wollen – bin ich
beglückt. Musik ist kein Religionsersatz, aber Musik ist genau das, was wir
alle brauchen. Sie ist fähig, Menschen seelisch gesund zu erhalten und sie
zu öffnen für die Umgebung, für die Allgemeinheit, für die Familie, für die
Freunde; und sie beweist, dass das Leben wert ist gelebt zu werden.
Kurt Masur
über Peenemünde
Peenemünde ist Usedoms be-
rühmtester Ort. Hier nahm die
Raumfahrt ihren Ausgang.
Doch die Entwicklung tödli-
cherWaffenwar das Ziel. In der
Heeresversuchsanstalt der
Nationalsozialisten kamen
viele tausend Zwangsarbeiter
ums Leben. Die Peenemünder Kon-
zerte des Usedomer Musikfesti-
vals stellen sich der schweren
Geschichte des Ortes. Als einsti-
gem Kriegsteilnehmer ist es Kurt
Masur ein besonderes Bedürfnis,
von diesem Ort aus friedliche
Botschaften zu senden.
Bild oben:
Kurt Masur bei den
Proben zum Eröffnungs-
konzert des Usedomer
Musikfestivals 2012 in
Peenemünde
Aufgezeichnet
von Alexander Datz
Foto
Geert Maciejewski

















